Verdi Giuseppe, Komponist. Geb. Le Roncole, Kg.reich Italien (I), 9. oder 10. 10. 1813; gest. Mailand (Milano, I), 27. 1. 1901. Sohn von Carlo V. und Luigia, geb. Uttini; in 1. Ehe mit Margherita Barezzi, in 2. Ehe mit →Giuseppina Strepponi verheiratet. – V.s musikal. Talent wurde in der Kleinstadt Busseto entdeckt, Förderer um seinen späteren Schwiegervater Antonio Barezzi entschieden, ihn zum Stud. nach Mailand zu schicken. Am dortigen Konservatorium scheiterte V. jedoch 1831 an der Aufnahmeprüfung. So finanzierten ihm seine Mäzene privaten Unterricht in Mailand, wo V. in Kontakt zu einflussreichen Adeligen kam, darunter auch solchen, die wie Renato Borromeo dem österr. K. treu ergeben waren. Auf einen Text Borromeos komponierte er eine Huldigungskantate zum Geburtstag von K. →Ferdinand I., die 1836 im Gymn. an der Porta Nuova uraufgef. wurde, deren Musik sich jedoch nicht erhalten hat. Im selben Jahr hatte V. die Stelle eines städt. Musikdir. in Busseto angetreten. Nach vergebl. Versuchen, eine Oper am herzogl. Theater in Parma zur Auff. zu bringen, kündigte er 1839 diese Anstellung, um sein Glück in Mailand zu versuchen. Seine erste vollendete Oper „Oberto, conte di S. Bonifacio“ wurde im November 1839 am Teatro alla Scala erfolgreich aufgef. und ein Jahr später erneut gespielt. Mit „Un giorno di regno“ (1840), „Nabucodonosor“ (1842), „I Lombardi alla prima crociata“ (1843) und „Giovanna d’Arco“ (1845) folgten vier weitere Kompositionsaufträge für das vom Vizekg. mitfinanzierte Opernhaus, den Klavierauszug von „I Lombardi“ widmete V. seiner „Landesmutter“ →Maria (Marie) Louise. „Nabucodonosor“ war V.s erste Oper, die außerhalb des italien. Sprachraums gespielt wurde, im April 1843 an der Wr. Hofoper in Anwesenheit des Komponisten. 1844 gelang ihm mit „Ernani“ ein durchschlagender Erfolg am Teatro La Fenice in Venedig. Mit der in kürzester Zeit in ganz Italien, dann auch weltweit nachgespielten Oper etablierte sich V. (nach Rossinis Rückzug, Bellinis Tod und dem Verstummen →Gaetano Donizettis) als führender italien. Opernkomponist. Obwohl er weiterhin in Mailand wohnte, wurde nun Venedig – neben Rom, Neapel und Florenz – die wichtigste Stadt für sein Schaffen. 1847 debüt. V. mit „I masnadieri“ in London und mit „Jérusalem“ in Paris, anschließend verzögerte er die Rückkehr nach Mailand. Erst nach den zunächst erfolgreichen Cinque giornate vom März 1848 kehrte er in die von einer Revolutionsregierung geführte Stadt zurück. Allerdings betrachtete er – trotz erklärter Sympathien für ein republikan. Italien – die weiteren Entwicklungen, v. a. die Rückeroberung der Lombardei unter →Johann Josef Wenzel Gf. Radetzky von Radetz im August 1848 aus sicherer Entfernung. Nach der Niederschlagung aller Revolutionen nahm er im August 1849 Wohnsitz in Busseto und mied bis in die späten 1860er-Jahre Mailand – möglicherweise auch wegen der opportunist. Haltung weiter Tle. der dortigen Funktionseliten gegenüber der österr. Monarchie. In den 1850er-Jahren verdankten sich entscheidende Werke – wie „Rigoletto“ (1851), „La traviata“ (1853) und „Simon Boccanegra“ (1857) – wiederum Aufträgen aus Venedig. Zuvor waren die Opern „Il corsaro“ (1848) und „Stiffelio“ (1850) in Triest uraufgef. worden. Während des Kriegs von 1859 fand sich V. – wie viele Republikaner – mit einer staatl. Einigung unter Führung des Kg.reichs Piemont-Sardinien ab. Auf Drängen des späteren Premierministers Camillo Benso Gf. v. Cavour war er sogar bereit, als Abg. für das erste italien. Parlament zu kandidieren und erfüllte diese Funktion bis 1865. Trotz (oder gerade wegen) der neuen polit. Situation nahm er in den folgenden Jahrzehnten nur noch Kompositionsaufträge aus dem Ausland an: „La forza del destino“ (1862) für St. Petersburg, im selben Jahr die orator. Gelegenheitskomposition „Cantica (Inno delle nazioni)“ für die Londoner Weltausst., „Don Carlos“ (1867) für Paris, „Aida“ (1871) für Kairo. Reisen nach Venedig, dessen Verbleib unter habsburg. Herrschaft bis 1866 V. verbitterte, sind nach 1857 keine mehr dokumentiert. Nach dem vorläufigen Abschluss der italien. Einigung (mit der Besetzung Roms im September 1870) ließ sich V. immer mehr in die Rolle des herausragenden Repräsentanten der Nation drängen. Damit lag es für ihn nahe, die 1874 in Mailand zum Gedenken an →Alessandro Manzoni aufgef. „Messa da Requiem“ auch international bekannt zu machen, so in vier von ihm selbst geleiteten Konzerten an der Wr. Hofoper im Juni 1875. Während dieses Aufenthalts dirigierte er dort auch „Aida“. In einer Zeit, in der allenthalben versucht wurde, auch der Oper distinkte nationale Eigenschaften zuzuweisen, wurde V. über seinen Tod hinaus – in Wien wie überall auf der Welt – als der wichtigste Vertreter italien. Musik wahrgenommen, nicht zuletzt mit den späten Shakespeare-Opern „Otello“ (Mailand 1887, Wr. Erstauff. 1888) und „Falstaff“ (ebd. 1893, Wr. Erstauff. im selben Jahr). V. wurde 1875 mit dem Komturkreuz mit Stern des Franz Joseph-Ordens ausgez.
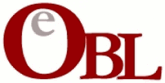
Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural Heritage
Österreichisches Biographisches Lexikon |
